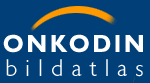
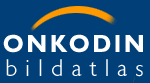
Pleuraergüsse, Perikardergüsse und Aszites sind Flüssigkeitsansammlungen in präformierten Höhlen, die normalerweise beim Gesunden nur jeweils wenige Milliliter Flüssigkeit als Gleitfilm enthalten, um die Exkursionen der darin liegenden parenchymatösen Organe, also der Lunge, des Herzens und des Darmkonvolutes, zu erleichtern. Diese Körperhöhlen sind von serösen Häuten ausgekleidet. Die Serosa besteht aus einschichtigem Mesothel, darunter liegt eine Bindegewebsschicht, und darunter befinden sich ein Kapillarnetz und Lymphgefäße. Das innere, viszerale Blatt der Serosa liegt dem parenchymatösen Organ direkt auf und ist mit diesem verwachsen. Das äußere, parietale Blatt kleidet die Innenseite des Brustkorbes, des Herzbeutels oder der Bauchhöhle aus. Zwischen dem Organparenchym und der Serosa läuft ständig ein Flüssigkeitsaustausch ab mit Filtration von Flüssigkeit in die Körperhöhle und Reabsorption über die Serosa. Für die Pleura wird beim Gesunden ein Umsatz von 5-10 Litern pro Tag angegeben. Die lymphatischen Lakunen der Serosa sind zur mesothelialen Oberfläche hin offen, die Körperhöhlen sind also gewissermaßen eine Erweiterung des lymphatischen Systems.
Wenn der normale Flüssigkeitsaustausch zwischen parenchymatösem Organ und Serosa gestört ist, sammelt sich Flüssigkeit in der Körperhöhle an. Die wichtigsten Mechanismen sind folgende:
Häufig liegen mehrere dieser Faktoren gleichzeitig vor.
Laboranalytisch wird zwischen eiweißarmen Transsudaten mit einem Eiweißgehalt von weniger als 3 g/l und eiweißreichen Exsudaten mit einem Eiweißgehalt von mehr als 3 g/l unterschieden. Transsudate entstehen durch eine passive Filtration von Blutflüssigkeit durch intakte Kapillarwände, z.B. Stauungsergüsse bei Herzinsuffizienz oder Ergüsse bei nephrotischem Syndrom. Bei Exsudaten liegt immer ein entzündlicher Reiz mit Kapillarschädigung und erhöhter Kapillarpermeabilität vor. Früher hat man angenommen, dass Transsudate fast immer benigne, Exsudate dagegen häufig maligne seien. Praktisch ist diese strenge Unterscheidung zwischen Transsudat und Exsudat nicht immer hilfreich. Ein maligner Erguss eines kachektischen Tumorpatienten kann vom Eiweißgehalt her durchaus einem Transsudat entsprechen. Andererseits finden wir bei länger bestehenden kardialen Stauungsergüssen ohne jegliche Entzündung häufig einen erhöhten Eiweißgehalt durch Eindickung der Ergussflüssigkeit unter diuretischer Therapie.
Zur zytologischen Untersuchung von Körperhöhlenergüssen werden mindestens 60 bis 80 ml mit Heparin versetzte, frisch gewonnene Punktionsflüssigkeit benötigt. Das Heparin sollte in der Spritze vorgelegt werden, um eine Gerinnung der Flüssigkeit zu verhindern. Dazu gibt man in mehrere 20ml-Spritzen jeweils ca. 1 ml Heparin, zieht den Kolben bis zum Anschlag zurück und benetzt durch Drehen der Spritze die Wand mit Heparin. Anschließend spritzt man das Heparin wieder aus, führt die Punktion durch und aspiriert die Punktionsflüssigkeit in die mit Heparin benetzten Spritzen.
Die Spritzen werden am Bett beschriftet und mit einem Anforderungsschein sofort ins zytologische Labor gebracht, damit das Material dort ohne Verzögerung verarbeitet werden kann. Kann das Material nicht sofort verarbeitet werden (z.B. nachts oder am Wochenende), sollte es im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Die Pappenheim-Färbung ist eine Kombination der Färbungen nach May-Grünwald und Giemsa. Sie wird für luftgetrocknete Präparate verwendet.
Reagenzien:
Färbevorschrift:
Fixierung:
Die Präparate müssen unmittelbar nach dem Ausstreichen feucht für mindestens 20 Minuten bis 24 Stunden in einem Gemisch aus Äther und 95% Alkohol (zu gleichen Teilen) fixiert werden.
Färbevorschrift:
Die Präparate werden feucht weiterverarbeitet.
Färbeergebnis:
leuchtend orange-gelblich: keratinisierte Zellen
eosinophil: Zytoplasma der ausgereiften Zellen des Plattenepithels
zyanophil (hellblau-grünlich): Zytoplasma der Zellen aus den tiefen Schichten des
Plattenepithels
schwarzbraun: Zellkerne
rötlich: Nukleolen
zartorange: Erythrozyten
Alle gefärbten Präparate, bei Untersuchungen von Ergussflüssigkeit also normalerweise vier Ausstriche pro Fall, werden komplett mit dem 10er-Objektiv durchgemustert. Der Objektträger wird mit dem Mattrand nach links in den Kreuztisch eingespannt. Man beginnt am unteren rechten Objektträgerrand - im Mikroskop ist das der obere linke Rand - und mikroskopiert das Präparat in horizontaler Richtung mäanderförmig bis zum Ende durch, wobei sich die zu betrachtenden Gesichtsfelder etwas überlappen sollten. Alle Zellen müssen mit der Vergrößerung im 10er-Objektiv sicher erkannt werden. Wenn man eine verdächtige Zelle oder einen verdächtigen Zellverband findet, überprüft man die Stelle mit der nächsthöheren Vergrößerung, z. B. mit der 40er- oder 50er-Ölimmersion.
Alle verdächtigen Zellen werden mit einem Stift auf der Unterseite des Objektträgers markiert. Dazu stellt man die zu markierende Stelle mit dem 10er-Objektiv in die Mitte des Gesichtsfeldes ein und dreht den Kondensor ganz nach unten. Den Objektträger mit dem Finger auf dem Kreuztisch etwas fixieren und den Stift zwischen Kondensor und Kreuztisch unter den Objektträger ins Strahlenfeld führen. Schaut man jetzt ins Mikroskop, kann man die Stiftspitze sehen und damit genau neben oder unter der Zelle einen Punkt setzen.
Sinnvoll ist es, das Präparat immer auf die gleiche Art in den Kreuztisch zu spannen und die Zellen immer an der gleichen Seite zu markieren. Damit erleichtert man dem nächsten Untersucher das Wiederfinden der auffälligen Zellen. In unserem Labor verfasst die musternde MTA handschriftlich eine kurze Beschreibung des gemusterten Falles und gibt Präparate und Beschreibung an den Zytologen zur endgültigen Befundung weiter.
© ONKODIN 2004-2013 | Kopieren nur für persönliche Verwendung genehmigt. |